Schadenersatz nach einem Unfall
Durch einen Autounfall entsteht oft ein erheblicher Schaden. Um so ärgerlicher ist es, wenn nach dem Unfall die gegnerische Versicherung den Schaden am Auto nicht oder nicht komplett bezahlt und auch keine Vollkaskoversicherung einspringt.Wir vertreten Sie bei der Durchsetzung Ihrer berechtigten Ansprüche nach einem Autounfall. Wir beziffern die Schadenersatzforderung einschließlich Nutzungsausfall und setzten, sofern Sie durch den Unfall verletzt wurden, das Schmerzensgeld durch. Bei schweren Verletzungen sind medizinische Kenntnisse auf Seiten des Rechtsanwalts unerlässlich um auf Augenhöhe mit den Versicherungen verhandeln zu können. In unserer Kanzlei werden daher schwer Verletzte durch einen Fachanwalt für Verkehrsrecht und einen Fachanwalt für Medizinrecht vertreten.
Schadensersatz nach Verkehrsunfall - die fiktive Abrechnung
Als Geschädigter eines Verkehrsunfalls steht es Ihnen grundsätzlich frei, wie Sie den von der Versicherung zu erstattenden Schadensbetrag einsetzen. Sie können hierbei den Schaden auch „fiktiv", also auf Basis eines von Ihnen eingeholten Sachverständigengutachtens abrechnen. Gerade im Rahmen der fiktiven Abrechnung nehmen Haftpflichtversicherer umfangreiche Kürzungen vor. Viele dieser Kürzungen sind jedoch nicht zulässig. Stellt etwa der von Ihnen beauftragte Sachverständige fest, dass aufgrund des Schadensbildes eine Achsvermessung notwendig ist, sind diese Kosten zu erstatten, unabhängig von der Frage, ob die Achsvermessung durchgeführt wird und eine Rechnung vorgelegt werden kann oder nicht. Gerne verweisen Haftpflichtversicherer bei der Abrechnung auf Gutachtenbasis auf günstigere Referenzwerkstätten, um so den auszuzahlenden Schadensbetrag zu reduzieren. Solche Verweise sind jedoch nicht immer zulässig. Wenn Ihr Fahrzeug beispielsweise maximal drei Jahre alt oder scheckheftgepflegt ist, darf der Haftpflichtversicherer nicht auf eine günstigere Werkstatt verweisen.
Reparaturkosten nach einem Verkehrsunfall
Nach einem Verkehrsunfall haben Sie als Geschädigter Anspruch auf Ersatz der unfallbedingten Reparaturkosten gegenüber dem Haftpflichtversicherer des Schädigers, vorausgesetzt an dem Fahrzeug ist kein Totalschaden eingetreten. Gerne kürzen Haftpflichtversicherer die berechtigten Ansprüche, um Kosten zu sparen.
Mehr… Weniger…Nutzungsausfall – Wann bekomme ich den?
Die Verfügbarkeit und Gebrauchsmöglichkeit eines Fahrzeuges ist ein Vermögenswert. Kann ein Fahrzeug jedoch nicht genutzt werden, weil es durch den Unfall irreparabel beschädigt wurde oder gerade repariert wird, kann es nicht (mehr) genutzt werden. Dieser Nutzungsverlust kann, sofern kein Ersatzfahrzeug vorhanden ist und auch nicht angemietet wird, als Schaden ersetzt werden.
Mehr… Weniger…Reparatur trotz überschreiten der 130 %-Grenze
Eine Reparaturmöglichkeit gibt es auch in „knappen“ Fällen eines wirtschaftlichen Totalschadens, wenn der Geschädigte reparaturwillig ist und der Werkstattbetrieb es schafft, mit dem Endbetrag der Reparaturkosten unter der Schwelle für einen wirtschaftlichen Totalschaden („130%-Grenze“) zu bleiben, auch wenn sich aus dem vorher eingeholten Schadengutachten eine Überschreitung dieser Grenze ergibt.
Mehr… Weniger…Schadenersatz bei Reparatur in eigener Werkstatt
Betreibt der Geschädigte, wie zB bei Speditionen oder Busunternehmen üblich, eine eigene Werkstatt, so kann er natürlich die Reparatur nach einem Unfall auch in der eigenen Werkstatt vornehmen. Fraglich war, in welcher Höhe die gegnerische Versicherung die Reparaturkosten übernehmen muss.
Mehr… Weniger…Darf die Aufzeichnung einer Dash-Cam verwertet werden?
 Lange umstritten war die Verwertbarkeit von Aufzeichnungen so genannter „Dash-Cams" in Zivilprozessen. Dürfen private Videoaufzeichnungen aus dem fahrenden Auto heraus genutzt werden, um den genauen Verlauf eines Verkehrsunfalls nachweisen zu können?
Lange umstritten war die Verwertbarkeit von Aufzeichnungen so genannter „Dash-Cams" in Zivilprozessen. Dürfen private Videoaufzeichnungen aus dem fahrenden Auto heraus genutzt werden, um den genauen Verlauf eines Verkehrsunfalls nachweisen zu können?
Verkehrsregeln auf Parkplätzen
 Ereignet sich ein Unfall nicht im normalen Straßenverkehr, sondern auf Parkplätzen, ist die Klärung der Schuldfrage nicht so einfach, wie es oftmals den Anschein hat. Da die Regeln der Straßenverkehrsordnung nicht eins zu eins auch auf Parkplätze zu übertragen sind und diese Regeln auch nicht auf allen Parkplätzen in gleicher Weise gelten, ergeben sich viele Probleme.
Ereignet sich ein Unfall nicht im normalen Straßenverkehr, sondern auf Parkplätzen, ist die Klärung der Schuldfrage nicht so einfach, wie es oftmals den Anschein hat. Da die Regeln der Straßenverkehrsordnung nicht eins zu eins auch auf Parkplätze zu übertragen sind und diese Regeln auch nicht auf allen Parkplätzen in gleicher Weise gelten, ergeben sich viele Probleme.
Keine Verweisung an noch günstigere Werkstatt nach Unfall
 Nach einem Verkehrsunfall entscheidet grundsätzlich der Geschädigte, ob er seine Schadensberechnung auf Gutachtenbasis - also fiktiv - oder konkret anhand der Vorlage der Reparaturrechnung vornimmt. Bei der fiktiven Abrechnung werden seitens der Haftpflichtversicherungen regelmäßig Anzüge hinsichtlich verschiedenster Positionen vorgenommen.
Nach einem Verkehrsunfall entscheidet grundsätzlich der Geschädigte, ob er seine Schadensberechnung auf Gutachtenbasis - also fiktiv - oder konkret anhand der Vorlage der Reparaturrechnung vornimmt. Bei der fiktiven Abrechnung werden seitens der Haftpflichtversicherungen regelmäßig Anzüge hinsichtlich verschiedenster Positionen vorgenommen.
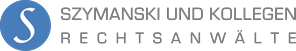
 Meistens führt die Überschreitung der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf der Autobahn im Falle eines Verkehrsunfalls zu einer Mithaftung des schnelleren Pkw.
Meistens führt die Überschreitung der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf der Autobahn im Falle eines Verkehrsunfalls zu einer Mithaftung des schnelleren Pkw. Auch im Totalschadensfall hat das beschädigte Fahrzeug noch einen gewissen Wert - den sogenannten Restwert, der in der Regel durch einen Sachverständigen ermittelt wird.
Auch im Totalschadensfall hat das beschädigte Fahrzeug noch einen gewissen Wert - den sogenannten Restwert, der in der Regel durch einen Sachverständigen ermittelt wird.