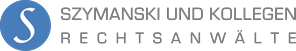Szymanski und Kollegen blogt - aktuelle Entscheidungen
Schwerbehinderte Menschen und das Präventionsverfahren im Arbeitsrecht
Auch während der Wartezeit nach § 1 Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) und den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs IX (SGB IX) wie § 173 Abs. 1 und § 168, in der schwerbehinderte Menschen noch keinen allgemeinen Kündigungsschutz genießen, ist ein Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX durchzuführen.
In einem aktuellen Urteil (LAG Köln, 12.09.2024, 6 SLa 76/24) hat das Landesarbeitsgericht Köln diese Verpflichtung bestätigt und damit eine bisherige Ansicht des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aus dem Jahr 2016 in Frage gestellt. Die frühere Rechtsprechung des BAG war davon ausgegangen, dass ein Präventionsverfahren während der Wartezeit entfallen könne. Das LAG Köln jedoch argumentierte, dass sich diese zeitliche Begrenzung weder aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt noch durch eine Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen gestützt wird.
Um Arbeitgebern die rechtlichen Anforderungen während der Probezeit zu erleichtern, entschied das LAG Köln, dass in solchen Fällen eine Beweiserleichterung zugunsten des Arbeitgebers greift. Hierdurch soll die Möglichkeit zur Probezeitkündigung auch bei schwerbehinderten Menschen erhalten bleiben, sofern die Kündigung nicht aufgrund der Schwerbehinderung erfolgt ist. Im konkreten Fall konnte die Kommune beweisen, dass die Kündigung nicht im Zusammenhang mit der Schwerbehinderung stand, sodass die Kündigung wirksam war.
Für eine detaillierte Analyse und Beratung in solchen Fällen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kündigung, Freistellung und Krankheit
Mit der Kündigung wird oft auch direkt eine Freistellung ausgesprochen. Kommt es dann zu einer Arbeitsunfähigkeit kann sich die Frage stellen, ob durch die Freistellung der Urlaub "verbraucht" wurde, wenn Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen.
1.Urlaubsanspruch trotz Freistellung:
Ein Arbeitnehmer verliert seinen Anspruch auf Urlaub nicht automatisch, wenn der Arbeitgeber ihn im Rahmen einer Kündigung von der Arbeitspflicht freistellt. Für die Erfüllung des Urlaubsanspruchs ist es erforderlich, dass eine Arbeitspflicht im betreffenden Zeitraum besteht. Nur wenn der Arbeitnehmer tatsächlich verpflichtet ist zu arbeiten, kann er von dieser Pflicht durch Urlaub befreit werden. Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in seinen Urteilen vom 18.03.2014 (9 AZR 669/12 und 9 AZR 877/13) ausdrücklich klargestellt.
2.Urlaub und Arbeitsunfähigkeit:
Ist der Arbeitnehmer arbeitsunfähig krank, ist es nicht möglich, ihn durch die Gewährung von Urlaub von seiner Arbeitspflicht zu entbinden. Dies bedeutet, dass ein Urlaubsanspruch während einer Krankheitsphase nicht erfüllt werden kann.
3.Nachweis der Arbeitsunfähigkeit:
Der Nachweis einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit erfolgt in der Regel durch die Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 EFZG. Laut § 7 Abs. 1 Nr. 1 EFZG genügt die Vorlage dieses ärztlichen Attests, um dem Arbeitgeber das Recht zu entziehen, die Entgeltfortzahlung zu verweigern (BAG Urteil v. 08.09.2021 - 5 AZR 149/21).
4.Erschütterung des Beweiswerts der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung:
Der Arbeitgeber hat jedoch die Möglichkeit, den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erschüttern. Dazu muss er konkrete Umstände darlegen, die Zweifel an der Erkrankung des Arbeitnehmers begründen. Ein bloßer Verdacht, wie beispielsweise der angebliche Besuch einer Feier oder eines Einkaufszentrums, reicht hierfür nicht aus (BAG Urteil v. 08.09.2021 - 5 AZR 149/21).
Schwangere müssen bei einer Kündigungsschutzklage nicht zwingend die 3 Wochenfrist einhalten
Das Arbeitsgericht Mainz hat im Anschluss an das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH C-284/23) im Vorabentscheidungsverfahren zugunsten einer schwangeren Klägerin entschieden, die in der Probezeit gekündigt worden war.
Nachdem die Klägerin zunächst keine Klage eingereicht hatte, teilte sie ihrer Arbeitgeberin drei Wochen nach Ablauf der Kündigungsfrist mit, dass eine Schwangerschaft festgestellt wurde, weshalb die Kündigung unwirksam sei. Die Kündigungsschutzklage reichte sie allerdings erst nach einem weiteren Monat ein.
Nach dem Mutterschutzgesetz war die Kündigung zwar unwirksam, doch nach der Auslegung der §§ 4,5 Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) hätte die Klägerin nach dem BAG dies normalerweise innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis ihrer Schwangerschaft geltend machen müssen. Das Arbeitsgericht Mainz legte dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob diese Regelung mit der EU-Richtlinie 92/85/EWG vereinbar sei.
Der Europäische Gerichtshof entschied, dass schwangere Arbeitnehmerinnen keine Klagefrist einhalten müssen, um sich gegen Kündigungen zu wehren. Dies gilt auch, wenn die Klage erst nach den nationalen Fristen eingereicht wird. Auf dieser Grundlage entschied das Arbeitsgericht Mainz, der Klage stattzugeben, obwohl sie verspätet eingereicht wurde.
Abrechnung nach Kostenvoranschlag - fiktiv - im Mietrecht, geht das noch?
Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat kürzlich entschieden, dass Vermieter Schadensersatzansprüche wegen Schäden an der Mietsache nach wie vor anhand eines Kostenvoranschlags fiktiv bemessen können, Urteil vom 19. April 2023, VIII ZR 280/21. Die gegenteilige Rechtsprechung des VII. Zivilsenats zum Werkvertragsrecht (Urteil vom 22. Februar 2018, VII ZR 46/17) beruht auf Besonderheiten des Werkvertragsrechts, die auf andere Vertragstypen wie etwa Mietverträge nicht übertragbar sind. Der VIII. Zivilsenat hält daher an seiner bisherigen Rechtsprechung fest.
Zum Sachverhalt:
Der Vermieter einer Wohnung verlangte nach Ende des Mietverhältnisses Schadensersatz, nachdem der Mieter erforderliche Schönheitsreparaturen nicht durchführt, selbst verlegten Bodenbelag sowie Fliesen nicht entfernte und Schäden im Treppenhaus verursachte. Der Vermieter holte daraufhin einen Kostenvoranschlag ein, wonach sich die Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungskosten auf ca. € 8.000,00 netto beliefen.
Der Vermieter führte die Rückbauarbeiten zum Teil selbst aus. Die übrigen Arbeiten ließ er nicht ausführen und verlangte von dem Mieter die dafür im Kostenvoranschlag ausgewiesenen Netto-Kosten als Schadensersatz.
Sowohl das erstinstanzlich zuständige Amtsgericht als auch das für die Berufung zuständige Landgericht wiesen die Klage ab, da eine fiktive Schadensberechnung nach deren Auffassung entsprechend der Entscheidung des VII. Zivilsenats vom 22. Februar 2018, VII ZR 46/17 nicht mehr vorgenommen werden dürfe.
Der für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat teilte diese Auffassung nicht, hob das Urteil des Landgerichts auf und verwies den Rechtsstreit zur erneuten Entscheidung dorthin zurück.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können Schadensersatzansprüche statt und neben der Leistung des Vermieters auch anhand der für die Instandsetzung oder -haltung erforderlichen (fiktiven) Netto-Kosten bemessen werden. Hieran ändert auch die bereits zuvor zitierte Entscheidung des VII. Zivilsenats nichts, da diese auf werkvertragsrechtlichen Besonderheiten beruht, die nicht auf das Mietrecht übertragbar sind.
Insbesondere besteht im Mietrecht keine Gefahr einer Überkompensation, da nur die zur Instandsetzung erforderlichen Kosten beansprucht werden können. Des Weiteren hat der Vermieter nach Beendigung des Mietverhältnisses keinen Anspruch mehr auf Zahlung eines Vorschusses für die Selbstvornahme.
Sollten Sie noch weitere Fragen zum Thema Schadensersatzansprüche des Vermieters nach Beendigung des Mietverhältnisses oder zu anderen mietrechtlichen Themen haben, beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Maximilian Blößer
Rechtsanwalt
Tätigkeitsschwerpunkt Mietrecht
Räumungsklage vor Ablauf der Kündigungsfrist - geht das?
Mit Beschluss vom 25. Oktober 2022, Az.: VIII ZB 58/21 hat der Bundesgerichtshof jüngst entschieden, dass Vermieter auch schon vor Ende der gesetzlichen Kündigungsfrist Räumungsklage erheben können, soweit die Besorgnis i.S.d. § 259 ZPO besteht, der Mieter werde sich der Verpflichtung zur Räumung und Herausgabe entziehen. Eine solche Besorgnis kann etwa dann gerechtfertigt sein, wenn der Mieter der Kündigung gem. §§ 574 ff. BB widerspricht, weil seine Suche nach Ersatzwohnraum bislang erfolglos geblieben ist und daher Obdachlosigkeit drohe.
Zum Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 23. Juni 2020 hatten die Vermieter das bestehende Wohnraummietverhältnis wegen Eigenbedarfs zum 31. März 2021 gekündigt. Mit anwaltlichem Schreiben vom 29. Januar 2021 widersprach der Mieter der Kündigung. Er teilte mit, dass er zwar bereits seit dem Ausspruch Kündigung eine andere Wohnung suche, aber noch nicht fündig geworden sei. Nach derzeitigem Stand wäre er daher ab Ende März 2021 obdachlos, sodass eine nicht zu rechtfertigende Härte im Sinne von § 574 Abs. 2 BGB vorliege. Am 22. Februar 2021 erhoben die Vermieter Klage, gerichtet auf Räumung und Herausgabe der Wohnung spätestens zum 31. März 2021. Der Mieter gab die Wohnung schließlich am 31. März 2021 an die Vermieter zurück, da er zwischenzeitlich doch noch eine andere Wohnung gefunden hatte.
Die Parteien erklärten den Rechtsstreit daraufhin in der Hauptsache für erledigt. Das erstinstanzlich zuständige AG Lübeck hatte daraufhin dem Mieter die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Auf dessen sofortige Beschwerde hin änderte das LG Lübeck die Entscheidung ab und belastete die Kläger mit den Kosten des Rechtsstreits. Das LG Lübeck vertrat die Auffassung, dass bei dem hiesigen Sachverhalt eine Klage auf künftige Leistung i.S.d. § 259 ZPO unzulässig sei.
Der BGH hob die Entscheidung des Landgerichts Lübeck wiederum auf und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung dorthin zurück.
Entgegen der Auffassung des LG Lübecks sieht der BGH in der vorliegenden Konstellation die Voraussetzungen des § 259 ZPO als gegeben an.
Auch wenn der Mieter nicht die Wirksamkeit der Kündigung an sich bestreitet, hat er im Rahmen des eingelegten Widerspruchs unmissverständlich zu erkennen gegeben, dass er bei unveränderter Situation, sprich bei weiterhin erfolgloser Wohnungssuche wegen drohender Obdachlosigkeit nicht bereits ist, aus der Wohnung auszuziehen. Diese Ankündigung reicht aus, um die Besorgnis nicht rechtzeitiger Leistung zu rechtfertigen.
Für die Besorgnis der nicht rechtzeitigen Leistung gilt dabei zugunsten von Wohnraummietern kein besonderer, von anderen Fallgestaltungen abweichender Maßstab. Wie auch in anderen Anwendungsfällen des § 259 ZPO ist allein die Besorgnis maßgeblich, der Schuldner werde die erklärte Absicht, sprich die fehlende Bereitschaft zur Erfüllung in die Tat umsetzen, sobald die Leistung fällig wird.
Sollten Sie noch weitere Fragen zur Räumungsklage oder zu anderen mietrechtlichen Themen haben, beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Maximilian Blößer
Rechtsanwalt
Tätigkeitsschwerpunkt Mietrecht
Mietrecht - Zahlung der ausstehenden Miete nach Zustellung der Räumungsklage
Der Bundesgerichtshof bestätigt seine bisherige Rechtsprechung, wonach die Nachzahlung von Mietschulden lediglich eine außerordentliche, nicht aber eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs heilt, Urteil vom 13.10.2021; Az.: VIII ZR 91/20.
Kündigt der Vermieter den Mietvertrag über die Wohnung außerordentlich wegen Zahlungsverzugs des Mieters, kann der Mieter gem. § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB durch vollständige Nachzahlung der Mietrückstände bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Rechtshängigkeit der Räumungsklage den Kündigungsgrund heilen. Man spricht insoweit von einer „Schonfristzahlung“. Eine Heilung tritt jedoch nicht ein, wenn das Mietverhältnis in den letzten zwei Jahren bereits wegen Zahlungsverzugs außerordentlich gekündigt wurde und der Mieter die Miete nachgezahlt hatte.
Aus dem vorgenannten Grund sollten Vermieter daher zusätzlich zur außerordentlichen Kündigung wegen Zahlungsverzugs hilfsweise die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses erklären. Wie der BGH nunmehr bestätigte, bleibt die ordentliche Kündigung auch bei Ausgleich der Mietrückstände wirksam.
Das LG Berlin war der Auffassung, dass § 593 Abs. 3 Nr. 2 BGB auch bei einer ordentlichen Kündigung gelte, mit der Folge, dass eine Schonfristzahlung auch die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung beseitige, Urteil vom 30.3.2020, Az.: 66 S 293/19. Zur Begründung wurde unter anderem angeführt, dass es der Zweck der Schonfristzahlung sei, Obdachlosigkeit zu verhindern.
Der BGH widersprach dieser Auffassung jedoch deutlich. Zunächst sei bereits der Wortlaut des § 569 Abs. 3 S. 2 BGB eindeutig, da sich dieser auf die Wirksamkeit einer Kündigung gem. § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB beziehe. Dieser eindeutige Wortlaut ist bei der Auslegung zu berücksichtigen. Die vom LG Berlin vorgenommene Auslegung, wonach eine Schonfristzahlung auch die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung beseitige, missachte daher die anerkannten Grundsätze der Gesetzesauslegung.
Dass sich die Wirkung einer Schonfristzahlung auf die außerordentliche Kündigung beschränkt, entspreche dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers, den auch der Tatrichter zu respektieren habe. Die Entscheidung des Gesetzgebers dürfe dabei nicht aufgrund eigener rechtspolitischer Vorstellungen verändert werden.
Die Entscheidung zeigt, dass der Verzug des Mieters mit der Entrichtung der Miete nicht folgenlos bleibt, auch wenn der Mietrückstand binnen der gesetzlich vorgesehenen Schonfrist ausgeglichen wurde.
Sollten Sie noch weitere Fragen zum Thema Kündigung eines Mietverhältnisses oder zu anderen mietrechtlichen Themen haben, beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Maximilian Blößer
Rechtsanwalt
Tätigkeitsschwerpunkt Mietrecht
Rückforderung Nebenkostenvorauszahlung bei fehlender Nebenkostenabrechnung?
Kann ich nach Ende des Mietverhältnisses die geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen zurückverlangen, wenn der Vermieter keine Abrechnung erteilt hat?
Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass der Mieter die geleisteten Vorauszahlungen auf die Betriebskosten zurückverlangen kann, wenn der Vermieter während des laufenden Mietverhältnisses nicht über die Betriebskostenvorauszahlungen abgerechnet hat. Der Rückzahlungsanspruch besteht jedoch nur für die Abrechnungsperioden, die während des laufenden Mietverhältnisses noch nicht abgelaufen sind, Entscheidung vom 7. Juli 2021, Az.: VIII ZR 52/20.
Zum Sachverhalt:
Der Mieter bewohnte von März 2012 bis April 2017 seine Wohnung. Bis einschließlich Juli 2016 zahlte er die Miete vollständig. Im August 2016 entrichtete er lediglich die Betriebskostenvorauszahlung und stellte ab September 2016 jegliche Zahlung ein. Der klagende Vermieter hatte während des gesamten Mietverhältnisses keine Betriebskostenabrechnung erstellt. Ansprüchen der Vermieterseite stellte der Mieter seine vermeintlichen Ansprüche auf Rückzahlung seiner Betriebskostenvorauszahlungen zur Aufrechnung entgegen.
Gem. § 556 Abs. 3 S. 1 BGB hat der Vermieter jährlich über die Betriebskostenvorauszahlungen abzurechnen. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen, § 556 Abs. 3 S. 2 BGB. Kommt der Vermieter dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Mieter bei beendetem Mietverhältnis unter dem Gesichtspunkt der ergänzenden Vertragsauslegung die geleisteten Vorauszahlungen zurückverlangen.
Dieser Anspruch besteht jedoch nicht unbegrenzt, sondern nur bzgl. der Vorauszahlungen für Abrechnungsperioden, deren Abrechnungsfrist bei Beendigung des Mietverhältnisses noch nicht verstrichen war. Für vorherige Abrechnungszeiträume ist der Mieter nicht schutzbedürftig, da er während des laufenden Mietverhältnisses ein Zurückbehaltungsrecht an den monatlichen Vorauszahlungen geltend machen kann, um den Vermieter zur Abrechnung zu bewegen.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt hatte dies zur Konsequenz, dass der Mieter nur die Betriebskostenvorauszahlungen für den Abrechnungszeitraum 2016 zurückfordern konnte.
Ohne Belang war dabei, dass der Mieter im Jahr 2016 tatsächlich von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch gemacht hat.
Ihr Mietverhältnis wurde beendet und es stehen noch Betriebskostenabrechnungen aus? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin.
Maximilian Blößer
Rechtsanwalt
Tätigkeitsschwerpunkt Mietrecht
Wann ist der Werklohn nach vorzeitiger Kündigung des Auftraggebers eigentlich fällig?
Das OLG München hat in seinem Beschluss vom 22.05.2023, Az.: 28 U 6295/22, noch einmal musterhaft zusammengefasst, wann der Werklohnanspruch des Auftragnehmers fällig wird.
Im konkreten Fall beauftragte der Auftraggeber den Auftragnehmer unter anderem mit der Setzung von Spundwänden für eine Tiefgarage. Nach Aufnahme der Bauarbeiten entschied sich der Auftraggeber, den Werkvertrag wegen angeblicher Mängel zu kündigen. Der Auftragnehmer legte dem Auftraggeber daraufhin die Rechnung für die bis zum Zugang der Kündigung erbrachte Werkleistung. Der Auftraggeber verweigerte den Ausgleich der Rechnung mit der Begründung, dass die Werkleistung nichts wert sei. Der Auftragnehmer klagte in der Folge seine Werklohnvergütung ein.
Das OLG München hat die Werklohnklage des Auftragnehmers mangels Abnahme zurückgewiesen.
Alleine durch die Kündigung des Auftraggebers sei noch kein Abrechnungsverhältnis zwischen den Vertragsparteien eingetreten. Vielmehr hätte der Auftragnehmer zunächst zur Abnahme der Werkleistung auffordern müssen. Die Abnahme sei auch nicht durch die Äußerung des Auftragnehmers (wertlose Leistung) nach Zugang der Rechnung entbehrlich geworden. Aus dieser Erklärung kann nicht die Verweigerung der Abnahme gesehen werden. Der Auftragnehmer hätte dem Auftraggeber daher zunächst eine angemessene Frist zur Abnahme der Werkleistung setzen müssen.
Die Entscheidung führt nochmals vor Augen, wie wichtig die richtige Vorgehensweise bei der (vorzeitigen) Beendigung des Werkvertrages ist. Die Abnahme ist im Baurecht von elementarer Bedeutung. Durch die Abnahme wird nicht nur die Werklohnvergütung fällig, sondern sie setzt auch den Beginn der Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers. Weiter geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder Verschlechterung des Werks auf den Besteller über. Die Abnahme ist nur im Ausnahmefall (z.B. Verweigerung) entbehrlich.
Sollten Sie Fragen zum Thema Abnahme der Werkleistung haben, beraten wir Sie gerne.
Schadensersatzforderung: Arbeitnehmer fordert über 44.500 EUR vom Arbeitgeber
Der Fall
Der Rechtstreit dreht sich um einen Arbeitnehmer, der vom Arbeitgeber Schadensersatz in Höhe von über 44.500 EUR gemäß § 37 des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) verlangt. Der Hintergrund der Klage ist die Ablehnung der Verlängerung seines befristeten Arbeitsvertrags bis zum 70. Lebensjahr durch den ArbG.
Der Arbeitnehmer behauptet, dass diese Entscheidung auf seine Meldung von Missständen im Klinikum zurückzuführen sei, insbesondere auf das Verhalten eines Mitarbeiters gegenüber einem Patienten. In einem Personalgespräch wurde er als „unkollegial“ bezeichnet und erhielt ein Schreiben mit der Mitteilung, dass sein Arbeitsverhältnis nicht verlängert werde. Der ArbN sieht sich daher als hinweisgebende Person gemäß HinSchG und fordert Schadensersatz gemäß §§ 36, 37 HinSchG.
Der Arbeitgeber bestreitet diesen Anspruch und argumentiert, dass der Arbeitnehmer keine Meldung an die gesetzlich vorgesehene interne oder externe Meldestelle gemacht habe und somit nicht als hinweisgebende Person gelte. Das Arbeitsgericht Hamm (16.2.24, 2 Ca 1229/23, Abruf-Nr. 241011) wies die Klage ab, da der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 37 Abs. 1 HinSchG habe.
Das Gericht entschied, dass der Schutzbereich des HinSchG nur für Personen gilt, die ihre Meldungen an die entsprechenden internen oder externen Meldestellen richten. Ein Hinweis im Rahmen eines Personalgesprächs erfülle diese Voraussetzungen nicht.
Relevanz für die Praxis
Diese Entscheidung unterstreicht, dass nicht jede Beschwerde über betriebliche Missstände einen Arbeitnehmer automatisch zur „hinweisgebenden Person“ im Sinne des HinSchG macht. Der Schutzbereich des Gesetzes ist nur bei Meldungen an die interne oder externe gesetzlich vorgeschriebene Meldestelle eröffnet.
Ausblick
Es ist zu erwarten, dass das neue Hinweisgeberschutzgesetz auch im arbeitsgerichtlichen Verfahren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Die Arbeitgeber sollten daher dringend für eine Umsetzung des HinSchG Sorge tragen und Meldungen der Arbeitnehmer entsprechend behandeln - andernfalls können hohe Schadensersatzforderungen auf sie zukommen.
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an!
Nutzungsausfall: Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 25. Januar 2024
Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat am 25. Januar 2024 (Az. 26 U 39/22) ein interessantes Urteil zum Thema Nutzungsausfall getroffen.
Hintergrund des Falls
Eine Autofahrerin parkte ihr Fahrzeug auf einer öffentlich zugänglichen Fläche vor dem Haus eines Bekannten. Während dieser im Krankenhaus lag, kam es zu einem Streit mit dessen Sohn. Der Sohn beschloss, das Auto umzuparken und stellte es auf einen privaten, mit einem Tor verschlossenen Hof. Der Fahrzeugschlüssel befand sich im Haus des Vaters, wodurch die Eigentümerin keinen Zugriff mehr auf ihr Fahrzeug hatte. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sich der Sohn, das Auto herauszugeben, und behauptete, es gehöre seinem Vater.
Gerichtliche Entscheidung
Nach Klärung der Eigentumsverhältnisse erhielt die Eigentümerin ihr Fahrzeug zurück und forderte vom Sohn eine Entschädigung für den Nutzungsausfall der Tage, an denen sie das Auto nicht nutzen konnte. Der Sohn lehnte dies ab und argumentierte, dass er nicht wissen konnte, dass das Fahrzeug nicht seinem Vater gehörte.
Urteil
Das OLG Frankfurt am Main entschied zugunsten der Klägerin. Das Gericht stellte fest, dass der Beklagte das Eigentum der Klägerin verletzt habe. Eine solche Verletzung bestehe auch darin, die Nutzung des Eigentums zu verhindern. Der Sohn konnte sich nicht darauf berufen, dass der Fahrzeugschlüssel im Haus seines Vaters lag, zumal keine Fahrzeugpapiere vorlagen, die das Eigentum des Vaters belegen konnten.
Das Gericht sprach der Klägerin einen Nutzungsausfall von 50 Euro pro Tag zu. Diese Summe sei für die erlittene Eigentumsverletzung angemessen.
Dieses Urteil verdeutlicht, dass das rechtswidrige Verhindern der Nutzung eines Eigentums einen Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung begründen kann. Eigentümer sollten sich ihrer Rechte bewusst sein und diese im Streitfall auch einfordern.
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an!
Verjährung von Mängelanspruchen an einer PV
Bei der Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Dach verjähren Mängelansprüche erst in fünf Jahren!
Der Werkunternehmer errichtete auf einem Wohnhaus eine Photovoltaikanlage. Die Abnahme erfolgte im Kalenderjahr 2010. Im Kalenderjahr 2017 zeigten sich Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich des Wohnhauses. Erst im Kalenderjahr 2020 leitete der Auftraggeber ein selbständiges Beweisverfahren ein. Der Sachverständige stellte eine fehlerhafte Montage der Photovoltaikanlage fest. Dadurch kommt es zu Wassereintritt an allen Gewindebolzen. Die Kosten zur Beseitigung der Mängel beziffert der Sachverständige auf € 111.000,00. Diesen Betrag klagt der Auftraggeber als Schadenersatz ein.
Die Klage wird abgewiesen. Der Schadensersatzanspruch nach Werkvertragsrecht ist verjährt. Gründe für eine Verlängerung der Verjährungsfrist wegen Arglist liegen nicht vor.
Festzuhalten ist zunächst, dass auf die Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage nicht Kaufrecht, sondern Werkvertragsrecht Anwendung findet. Weiter betont der BGH innerhalb seiner Entscheidung nochmals, dass bei einer festen Verbindung der Photovoltaikanlage mit dem Dach die Verjährungsfrist für Bauwerke von fünf Jahren und nicht die Regelfrist von drei Jahren gilt.
Sollten Sie nach einigen Jahren Mängel an Ihrer Photovoltaikanlage feststellen, gilt es zeitnah die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls bleiben Sie unter Umständen auf hohen Kosten sitzen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Einleitung der richtigen Maßnahmen.
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.
Werkstattrisiko greift auch für "dubiose" Positionen
BGH vom 16.1.2024, Az. VI ZR 51/23
Ein Autofahrer erlitt einen unverschuldeten Verkehrsunfall. Er ließ ein Gutachten über den entstandenen Schaden machen und das Fahrzeug reparieren. Die Werkstatt rechnete neben den reinen Reparaturleistungen auch eine Covid-19-Reinigung in Höhe von ca. 39,- € ab.Diese Position erstattete die Versicherung nicht. Sie verwies darauf, dass gar nicht nachgewiesen sei, ob diese Leistung überhaupt erbracht wurde und ob sie notwendig war.Nunmehr gab der BGH dem geschädigten Kläger Recht.Die Richter wiesen darauf hin, dass derjenige, der schuldlos einen Unfall erlitten hat, einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Reparatur hat. Rechnet die Werkstatt Positionen ab, von denen nicht klar ist, ob diese wirklich erbracht wurden, darf das nicht zu Lasten des Geschädigten gehen. Das sog. Werkstattrisiko bleibe in diesen Fällen beim Schädiger bzw. dessen Versicherung. Es sei für den Geschädigten gar nicht erkennbar oder nachvollziehbar, ob diese Reparatur-Position durchgeführt wurde oder nicht. Er dürfe darauf vertrauen, dass die Werkstatt nur notwendige und sinnvolle Arbeiten ausführe.
Kündigung nach Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier ist eine beliebte Tradition in vielen Unternehmen, um das Jahr ausklingen zu lassen und den Teamgeist zu stärken. Leider kann es in manchen Fällen vorkommen, dass diese festliche Veranstaltung unangenehme rechtliche Konsequenzen nach sich zieht, wenn sich Arbeitnehmer dort nicht korrekt verhalten.
Wann kann eine Kündigung nach der Weihnachtsfeier rechtens sein?
Eine Kündigung nach der Weihnachtsfeier aufgrund von Belästigung kann gerechtfertigt sein, wenn die Belästigung ernsthaft war und gegen Arbeitsplatzrichtlinien oder gesetzliche Vorschriften verstoßen hat. Beispiele für Belästigung können sexuelle Übergriffe, diskriminierende Bemerkungen oder aggressives Verhalten gegenüber Kollegen sein. In solchen Fällen ist es wichtig zu wissen, dass die rechtliche Seite der Angelegenheit komplex sein kann.
Die jüngste Entscheidung des ArbG Elmshorn (3 Ca 1501 e/22) stellte klar, dass auch bloße unerwünschte Bemerkungen sexuellen Inhalts eine sexuelle Belastigung und damit einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung betreffen können. Dann sei auch eine vorherige Abmahnung entbehrlich.
Wie kann ein Rechtsanwalt in Gelnhausen Ihnen helfen?
Rechtsberatung: Unsere erfahrenen Rechtsanwälte und Fachanwälte - Rechtsanwalt Jan Szymanski und Rechtsanwältin Julia Habelt - informieren Sie umfassend über Ihre Rechte und Pflichten. Wir analysieren die Situation und zeigen Ihnen klar auf, welche Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen.
Beweissicherung: Ihr Anwalt wird Ihnen bei der Sammlung von Beweisen für den Vorfall behilflich sein. Dies kannZeugenaussagen, E-Mails, Fotos oder andere relevante Dokumente umfassen.
Verhandlungen: In einigen Fällen kann es möglich sein, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, um eine außergerichtliche Lösung zu finden, die für beide Parteien akzeptabel ist. Ihr Anwalt wird Ihre Interessen dabei bestmöglich vertreten.
Klageerhebung: Wenn eine außergerichtliche Einigung nicht möglich ist, wird Ihr Anwalt die rechtlichen Schritte einleiten und Sie vor Gericht vertreten, um Ihre Rechte zu schützen.Fazit
Fazit
Eine Kündigung nach der Weihnachtsfeier wegen Belästigung ist eine ernsthafte Angelegenheit, die das Leben und die Karriere eines Einzelnen erheblich beeinflussen kann. Wenn Sie sich in einer solchen Situation befinden, sollten Sie nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Rechtsanwalt in Gelnhausen, der auf Arbeitsrecht spezialisiert ist, kann Ihnen dabei helfen, die bestmögliche Lösung für Ihre Situation zu finden.
Vertrauen Sie auf die Erfahrung und das Fachwissen eines Anwalts und Fachanwalts für Arbeitsrecht, um Ihre Rechte zu verteidigen. Bei Fragen oder rechtlichen Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie unsere Rechtsanwaltskanzlei in Gelnhausen, um einen Termin für eine persönliche Beratung zu vereinbaren. Wir sind für Sie da, um Sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und Ihnen den bestmöglichen Rechtsbeistand zu bieten.
Keywords: Kündigung, Rechtsanwalt, Gelnhausen, Weihnachtsfeier, Belästigung, Arbeitsrecht.
Das betriebliche Eingliederungsmanagement - BEM - das unbekannte Wesen
Wenn Arbeitnehmer aufgrund gesundheitlicher Probleme langfristig ihre Arbeitsleistung nicht erbringen können, stehen Arbeitgeber vor komplexen Herausforderungen. Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein gesetzlich verankertes Instrument, das genau in solchen Fällen greift. Ziel des BEM ist es, den Arbeitnehmer nach längerer Krankheit (mehr als sechs Wochen innerhalb eines Jahres) wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren und zukünftige Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden.
Vor einer personenbedingten Kündigung ist der Arbeitgeber rechtlich verpflichtet, ein BEM durchzuführen. Dies dient nicht nur dem Wohl des Mitarbeiters, sondern schützt auch den Arbeitgeber vor rechtlichen Risiken. Denn ohne ein ordnungsgemäßes BEM sind personenbedingte Kündigungen oft angreifbar und können vor Gericht erfolgreich angefochten werden.
Das Verfahren des BEM sollte sehr sorgfältig vorbereitet und wohl dokumentiert sein und die Beteiligung des betroffenen Mitarbeiters, des Betriebsrates, des Betriebsarztes sowie gegebenenfalls der Schwerbehindertenvertretung umfassen. Hierbei geht es nicht um die Klärung der Ursache der Krankheit, sondern um praktische Maßnahmen, die die Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters wiederherstellen sollen.
Als Ihr Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gelnhausen berate ich Sie gerne umfassend zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des BEM und prüfe die rechtssichere Basis der personenbedingten Kündigungen.
Zögern Sie nicht, uns für eine individuelle Beratung zu kontaktieren.
LG Hagen vom 31.5.2023, Auffahrunfall auf der Autobahn
Ein Lkw fuhr auf ein Stauende zu und bremste laut Fahrtenschreiber von 62 km/h auf 11 km/h ab innerhalb von 29 Sekunden, die zulässige Geschwindigkeit betrug 100 km/h. Einen Warnblinker hatte er nicht eingeschaltet, der hinter ihm Fahrende erkannte die Situation nicht und fuhr mit 50 km/h auf den Lkw auf. Der Auffahrende wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die Kranken- und Pflegeversicherung forderte von der Versicherung des Lkw Schadenersatz für geleistet Behandlungskosten. Sie war der Ansicht, dass der Lkw-Fahrer eine Pflicht gehabt hätte, die Warnblinkanlage einzuschalten. Da er das Unterlassen habe, sei der Unfall von ihm verschuldet worden. Die Versicherung sah aufgrund der konkreten Unfallsituation keinen erheblichen Pflichtverstoß des Lkw-Fahrers und verweigerte die Zahlung. Das LG Hagen wies die Klage mit der Begründung ab, dass es keine generelle Pflicht gibt, an einem Stauende die Warnblinker anzustellen. Eine solche Verpflichtung könne sich nur aus § 1 Abs. 2 StVO ergeben, wenn eine besondere Gefahrenlage erkennbar sei. In diesem Fall sei genau das aber nicht der Fall gewesen. Der Stau bildete sich nur auf der rechten Spur, was häufiger vorkomme, da langsame Lkw oder Auf- und Abfahrten den Verkehrsfluss beeinträchtigen können. Zudem sei ein Tempolimit von 100 km/h angeordnet gewesen und der Lkw-Fahrer habe moderat die Geschwindigkeit reduziert, als er den Stau wahrnahm. Es sei hell gewesen und der Straßenverkauf war gerade. Wenn der Hintermann dennoch mit 50 km/h auffahre, sei davon auszugehen, dass er sich grob verkehrswidrig verhielt, indem er den vorausfahrenden Verkehr nicht beobachtete. In einer solchen Situation sei es zudem fraglich, ob das Einschalten der Warnblinker überhaupt den Unfall verhindert hätte. Das sei ein so grober Verkehrsverstoß, dass die Betriebsgefahr des Lkw vollkommen zurücktrete.
BAG, Urteil vom 28.3.2023 – 9 AZR 488/21
Tilgungsreihenfolge und Mitwirkungsobliegenheit beim Urlaub
Sofern der Arbeitgeber keine Tilgungsbestimmung i. S. v. § 366 I BGB vornimmt, sei die in § 366 II BGB vorgegebene Tilgungsreihenfolge mit der Maßgabe heranzuziehen, dass zuerst gesetzliche Urlaubsansprüche und erst dann den gesetzlichen Mindesturlaub übersteigende Urlaubsansprüche erfüllt würden.
Der gesetzlicher Mindesturlaub, den ein Arbeitnehmer erworben hat, bevor er aufgrund einer seitdem ununterbrochen fortbestehenden Krankheit arbeitsunfähig geworden ist, kann bei einer richtlinienkonformen Auslegung des § 7 I und III BUrlG grds. nur dann nach Ablauf eines Übertragungszeitraums von 15 Monaten erlöschen, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer durch Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheiten rechtzeitig vor Krankheitsbeginn in die Lage versetzt hat, seinen Urlaub zu nehmen.
11.7.2023 - OVG Saarlouis: Fahrtenbuchauflage trotz Nennung des Fahrers
OVG Saarlouis vom 7.6.2023, Az. 1 B 51/23
Kann der Fahrzeugführer nach Anhörung des Halters nicht ermittelt werden, kann die Verwaltungsbehörde ein Fahrtenbuch verhängen, sofern der Halter den tatsächlichen Fahrer nicht benannt hat. In dem Verfahren vor dem OVG Saarlouis benannte der Halter zwar einen Mitarbeiter, im Nachgang stellte sich aber heraus, dass dieser nun doch nicht der Fahrer war. Dieser Mitarbeiter der Halterin füllte den zugesandten Anhörungsbogen zwar aus und gab an, das Fahrzeug geführt zu haben. Einige Zeit später trug sein Anwalt aber vor, der Mitarbeiter sei doch nicht der Fahrer gewesen. Vor Gericht konnte die Identität nicht tatsächlich geklärt werden, das Verfahren wurde eingestellt und es erging eine Fahrtenbuchauflage. Dagegen legte er Widerspruch ein.
Nach der Entscheidung des OVG Saarlouis sei die Auflage verhältnismäßig. Die Halterin habe zwar zunächst mitgewirkt, indem sie den Bogen an den berechtigten Mitarbeiter weitergab. Dieser habe aber durch die späteren falschen Angaben die Verfolgung vereitelt. Sollte die Halterin selbst den Bogen ausgefüllt haben, spreche alles dafür, dass das beigefügte Foto und die Tatsache, das das Fahrzeug normalerweise von einer anderen Person gefahren wird, nicht geprüft wurde. Daher sei die Auflage angemessen.Die Halterin des Dienstfahrzeuges hätte diese Unsicherheit vermeiden können, wenn Sie Fahrtenbücher geführt hätte.